DayZ: Tagebuch, Teil 1

Die letzten Wochen sahen zwei Großereignisse in Videogamehausen. Beide hatten apokalyptische Untertöne, aber nur eines seine Propheten: Blizzard versuchte die Hölle heraufzubeschwören mit der Veröffentlichung von Diablo III, und fand sich unverhofft selbst im Zentrum von Heuschreckenstürmen und Krötenschauern wieder. Die riskante Entscheidung, große Teile der Daten auf hauseigenen Servern zu bearbeiten, schlug zurück und verursachte millionenfach Unmut. Enttäuscht wurden viele, wirklich überraschend war es dennoch nicht.
Die zweite Apokalypse fand unter exakt umgekehrten Vorzeichen statt: Sie konnte niemanden enttäuschen, denn niemand sah sie kommen. In einer anderen Dimension, als sie der Blizzardsche Höllenfürst mit seinen Mitternachtsverkäufen und seinem Jahre überspannenden Hype-Zyklus bewohnt, wurde unvermittelt ein Spiel auf die Welt losgelassen, das längst nicht nur Verächter der feinbalancierten Klickorgien um sich schart. Erstaunlich genug, ist DayZ doch nicht einmal ein eigenständiges Spiel, sondern lediglich die Vorabversion der Rumbastelei an einer notorisch sperrigen Militärsimulation: Eine Multiplayer-Mod, die den auf Krieg getrimmten Detailfetischismus in Sachen Geographie, Balistik und Zerstörbarkeit der Körper von Arma 2 – Combined Operations nimmt und ihn im übernatürlichen Schrecken unendlich potenziert.

Dadurch wird DayZ zu viel mehr als nur zur Mod des Monats: Es wird zur Neudefinition des Genres Survival Horror, die alle vorangehenden Versuche als Geisterbahnspäßchen entlarvt. Es wird in der Anwesenheit der 49 anderen Spieler, die jeden Server bewohnen, zum Diorama der Degenerierung von Menschlichkeit im Angesicht unmenschlicher Herausforderungen – punktuiert von aufflackerenden Momenten unerwarteter Großzügigkeit. Und es wird zum besten Argument dafür, dass die Steigerungsform von Immersion nichts anderes als PANIK ist. Noch vor allem anderen aber ist DayZ in seiner ungeheuren Komplexität und Unberechenbarkeit die nächste große Geschichtengeneriermaschine, die dieses Medium hervorgebracht hat… lasst uns also eine Geschichte erzählen.
Am Anfang von DayZ steht eine veritable Ur-Szene: Der Blick hebt sich, hinter einem branden Wellen gegen einen Strand mit endlosem Horizont, vor einem erstreckt sich eine leichte Böschung, auf der vereinzelt Bäume stehen. Am Rande des Blickfelds befindet sich eine Reihe von Symbolen, die mit dem Blick mitwandern: Kindliche Darstellungen eines Gesichts, einer Flasche, eines dickflüssigen Tropfens Blut und eines Essbestecks. Die Symbole verleiten zu einer Kontrolle des Gepäcks, in dem sich das Notwendigste findet: Verbandszeug, Medizin, eine Wasserflasche, eine Ration Bohnen – und eine Pistole mit Munition: Survival Tools. Das ist alles, und es ist unschwer zu erkennen, dass es nicht genug sein wird. Kein Kompass, keine Karte: Jede Marschrichtung ist so gut wie die andere.
Ich versuche, mich an die Küste zu halten, komme an einem Bootssteg vorbei, der ins Nirgendwo führt, und mache in der Ferne Strandhütten aus: Ein Wegpunkt. Als ich mich ihnen nähere, werde ich daran erinnert, dass ich nicht allein bin; in der Nähe der Häuser bewegt sich etwas. Mein Hirn spült Geschichten von Mitspielern nach oben, die zu Plünderern geworden sind, Mördern, die am Strand lauern auf Neuankömmlinge, um ihnen ihre spärliche Ausrüstung abzunehmen. Oder einfach nur um der Jagd willen: Die Apokalypse war immer noch die beste Ausrede dafür, sein inneres Arschloch ungestraft ausleben zu können. Doch die Bewegungen der Gestalten vor mir erscheinen mir zu abgehackt, zu bizarr, um einen menschlichen Mitspieler zu kennzeichen. Außerdem, weiß ich, teilt DayZ die detailfetischistische Logik des Spiels, auf dessen Skelett es gebaut wurde. Wäre das hier Arma 2 und die Silhouette vor mir ein auf Zerstörung gepolter menschlicher Mitspieler – er wäre er längst schon in Deckung gegangen und hätte mir über 600 Meter hinweg entlang einer ballistisch korrekt berechneten Flugbahn eine Kugel in den Kopf gejagt.

Die Alternative ist allerdings kaum tröstlicher: Die wankende Gestalt vor mir muss ein “Zehd” sein; einer der Zombies, die diese 200 Quadratkilometer osteuropäischer Ex-Idylle bevölkern und aus der Militärsimulation eine Simulation primärer Ängste machen: Survival. Horror. Die Neugierde triumphiert über den Überlebensinstinkt, und ich versuche, mich mit gezückter Waffe in einem weiten Bogen anzuschleichen. Der Zehd ist nicht allein; um die wie Monumente in den Sand gerammten Häuser torkeln noch mindestens zwei andere Untote, einer auf allen Vieren. Als ich noch versuche, die Situation neu zu beurteilen, höre ich ein dumpfes Stöhnen, und frage mich, ob es von meinem verwundeten Avatar stammt oder dem Zombie, der mich lautlos von hinten angefallen hat. Ich entleere das Magazin meiner Pistole in das, was wie der belebte Leichnam eines bretonischen Schäfers wirkt. Mit der vierten Kugel sackt er gurgelnd in sich zusammen, ich kann mich nicht beherrschen und feuere ein fünftes und ein sechstes Mal sinnlos weiter.
Ich lerne: Ein von Würmern abgenagtes Ohr bedeutet nicht zwingend den Verlust des Gehörs. Die Zombies, die ich vor dem bretonischen Zwischenfall im Auge behalten habe, wurden von den Schüssen aus der Lethargie geweckt und kommen auf mich zu – rasend schnell und in Zickzackmustern, die einen Strich durch jede Ziellinie machen. Ich tue, was jeder vernunftbegabte Noch-Mensch in meiner Situation tun würde: ich gebe Fersengeld. In meinem Sprint ins Nirgendwo erinnere ich mich an den Bootssteg, einige hundert Meter hinter mir, und fasse einen ad hoc-Plan: Ich renne um mein Leben, durch den Sand, den Steg entlang, und drehe mich mit der Entschlossenheit des Totgeweihten um. Mein Plan war eher ein Gedanke: Auf diesem Steg wird mich niemand hinterrücks anfallen können. Im Duell von Angesicht zu verrottetem Angesicht habe ich vielleicht eine Chance, kann den Untoten wenigstens ein letztes Gefecht von 80er-US-Action-Film-mässigem Pathos bieten. Ich wende mich also um, um meinem Verderben ins Antlitz zu blicken, und sehe… nichts.

Die Zombies sind nicht verschwunden; ihr durchgemoderter Orientierungssinn hat ihnen lediglich vorgegeben, dass der kürzeste Weg vom Strand zu mir durch das Wasser führt. Mir ist nie eingefallen, dass Zombies schwimmen können. Doch diese hier tummeln sich wie ein übergewichtiges DDR-Synchronschwimmteam zu meinen Füßen und geifern und hecheln dabei, als müsste das Wort ‘Seehund’ neu erfunden werden. Doch dies ist nicht Flipper und ich bin nicht fucking Sandy Ricks. Beim Dezimieren der ozeanischen Fauna bemerke ich, dass die Romerorschen Gebote auch in diesem Spiel gelten: Ein Schuss in den Kopf genügt, um einen Zombie in seinen ungestümen Ruderbewegungen zu stoppen. Noch eine Lektion, eine entscheidende in einer Welt, in der Munition ein so seltenes wie überlebensnotwendiges Gut ist. Erst jetzt bemerke ich auch, dass der Angriff des Hirten-Zombies Folgeschäden nach sich gezogen hat. Ich blute, oder besser: Ich blute langsam aus. Bevor ich weiterziehe, lege ich einen Verband an und frage mich, ob das vergossene Blut je wieder gut gemacht werden kann.
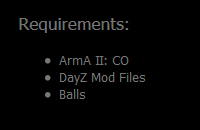
Einige Minuten später werde ich lernen, dass die Frage unerheblich ist. Ich habe mich ins Landesinnere vorgewagt und bin einer Bahnschiene entlang zu einem Dorf vorgestoßen. Die Felder, die das Dorf umgeben, sind voll von Zombies. Ich bewege mich öfters im Kriechgang als aufrecht vorwärts, um den Blicken der Untoten zu entkommen. Plötzlich lese ich im Chatkanal, der meinen einsamen Marsch als Hintergrundrauschen begleitet, die Worte: “You there, survivor near the bridge. I SEE YOU.” Ich liege im Gras, unweit einer Brücke, die ich umgangen habe, um unsichtbar zu bleiben. Wer mich hier sehen kann, tut es durch ein Zielfernrohr. Ich lasse alle Hoffnung fahren und renne los, auf die Siedlung zu. Kein Schuss fällt, doch ein Zombie nimmt meine Verfolgung auf. Als ich das letzte Mal wage, mich umzudrehen, ist es ein Pulk. Ich versuche, mich in eines der Häuser zu retten, erreiche seine Veranda – und kann die Tür nicht öffnen. Ich entleere meine letzten Magazine in die Masse von Kiefern und Klauen und breche auf der Türschwelle zusammen.